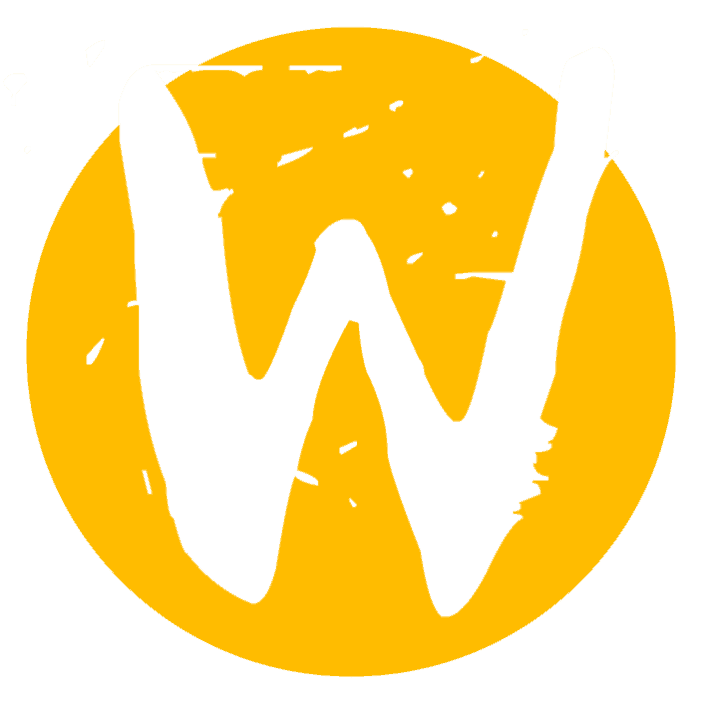ONLYOFFICE ist eine Office-Lösung für Privatanwender und Unternehmen, die von der in Riga in Lettland ansässigen Firma Ascensio System SIA entwickelt wird. Jetzt gibt das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Filesharing- und Synchronisationsdienst Nextcloud bekannt.
Freie Software
ONLYOFFICE steht unter einer GPLv3-Lizenz und legt einen Schwerpunkt auf Online-Dokumenten-Editoren sowie auf Projekt- und Dokumentenmanagement und wird als SaaS-Lösung oder als Installation für die Bereitstellung im privaten Netzwerk ausgeliefert. Der Zugriff auf das System erfolgt über ein privates Online-Portal.
Als Unternehmenslösung ist ONLYOFFICE kostenpflichtig, für den privaten Einsatz steht die kostenlose Lösung ONLYOFFICE Personal bereit. Die Software soll laut dem Hersteller 100 Prozent kompatibel mit Microsoft Office Formaten sein.
Jetzt gibt das Unternehmen in seinem Blog eine Partnerschaft mit der selbst gehosteten Kollaborationsplattform Nextcloud bekannt. Damit können Privatleute und Unternehmen auf einen HTML5-basierten Dokumenteneditor im Browser zugreifen, der nahtlos in die leistungsfähige Dateiaustausch- und Kommunikationsplattform Nextcloud integriert ist.
Offizielle App für ONLYOFFICE
Dabei können Benutzer innerhalb von Nextcloud Textdokumente, Tabellen und Präsentationen nun offiziell gemeinsam bearbeiten und austauschen. Denn eine App zur Integration der beiden Dienste stellt der Hersteller von ONLYOFFICE bereits länger zur Verfügung.
Zwei Lösungen
Damit verfügt Nextcloud mit ONLYOFFICE und dem auf LibreOffice basierenden Collabora Office gleich über zwei offiziell angebundene Bürolösungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zum gemeinsamen Erstellen und Pflegen von Dokumenten.
Laut eigenem Bekunden ist ONLYOFFICE mit fünf Millionen Nutzern einer der führenden Anbieter im Geschäft mit Online-Büro-Lösungen. Jos Portvliet von Nextcloud sagt über die Partnerschaft:
Hosting von Nextcloud und ONLYOFFICE On-Premises (auf eigenem Server) oder bei einem qualifizierten, vertrauenswürdigen lokalen Anbieter ermöglicht den Unternehmen, die Kontrolle über ihre Daten und ihre Kommunikation wiederzuerlangen, während die Produktivitätsvorteile der Cloud erhalten bleiben.