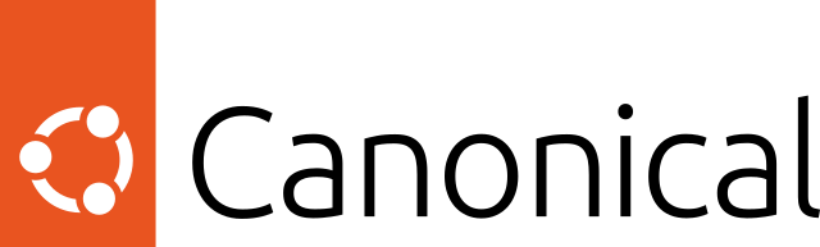Mit etwas Verspätung ist als letzte Ubuntu-Variante nun auch die insgesamt 15. Veröffentlichung von Lubuntu erschienen. Wichtigste Neuerung von Lubuntu 18.10 ist der endgültige Umstieg von LXDE zu LXQt, der eigentlich bereits mit Lubuntu 15.10 »Wily Werewolf« vollzogen werden sollte. Mit der Umstellung der Desktopumgebung geht auch eine Neudefinition der generellen Ausrichtung des Projekts einher.
LXQt statt LXDE
Mit dem Einzug des Lightweight Qt Desktop Environment (LXQt) wird die LXDE-Umgebung künftig nicht mehr unterstützt. LXQt kommt im neuen Release in Version 0.13.0 auf der Basis von Qt 5.11.1 auf die Festplatte. Unter den vorinstallierten Anwendungen finden sich Firefox 62, LibreOffice 6.1.2 mit Qt-Frontend, VLC 3.0.4, das Discover Software Center 5.13.5 und der Texteditor Featherpad. Anstelle des üblicherweise verwendeten E-Mail-Clients Thunderbird hat hier Trojita 0.7 den Zuschlag erhalten.
Aktuelle Grundlage
Als Grundlage dient, wie auch bei Ubuntu »Cosmic Cuttlefish« 18.10, Kernel 4.18 und ein aktueller Grafikstack mit X.Org 1.20.1 und Mesa 18.2. Zusammen mit dem LXQt-Desktop ergibt das ein leichtgewichtiges System. Der RAM-Verbrauch gleich nach dem Start liegt bei knapp unter 300 MByte, während dieser bei Ubuntu selbst bei rund 970 MByte liegt. Damit unterstreicht Lubuntu seinen Anspruch, performant auf Rechnern der letzten zehn Jahre zu laufen.
Calamares Installer
Anstelle des Ubiquity-Installers von Ubuntu kommt hier ein Installer auf der Basis des Calamares-Installer-Frameworks zum Zug. Es wird allerdings noch bis Lubuntu 19.04 dauern, bis Calamares alle Funktionen beinhaltet. Derzeit ist beispielsweise die »Minimal Install«-Option, die Ubuntu seit 18.04 anbietet, nicht verfügbar. Zudem beschreibt die Ankündigung Probleme mit UEFI und LUKS-Verschlüsselung. Bei einer Standard-Installation war davon nichts zu bemerken.
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass wegen des Wechsels der Desktop-Umgebung Updates von 18.04 schwierig sind und von daher offiziell nicht unterstützt werden. Wagemutige Anwender finden Unterstützung bei Problemen auf einer eigens eingerichteten Webseite.
Dokumentation
Besondere Aufmerksamkeit bei Lubuntu 18.10 wurde auf die Dokumentation in Form eines Handbuchs gelegt, das im Verlauf der folgenden Veröffentlichungen weiter ausgebaut und schließlich auf dem Image ausgeliefert werden soll. Zu den bekannten Problemen zählt ein Fehler beim Multi-Monitor-Betrieb, wo sich das Wallpaper über alle Monitore erstreckt Hier wird derzeit als Workaround ein Skript angeboten.
Messlatte 19.04
Lubuntu scheint derzeit auf gutem Weg, wird sich aber an der Veröffentlichung zu 19.04 messen lassen müssen. In letzter Zeit gab es neben technischen Problemen auch interne Diskussionen, um den künftigen Weg der Distribution zu bestimmen. Dabei stand unter anderem die Frage im Raum, wie mit der 32-Bit Prozessorarchitektur weiter verfahren werden soll, wenn sich fast alle anderen Ubuntu-Derivate davon abwenden.
Quo vadis?
Die neue Definition von Lubuntu fasst sich in der Aussage zusammen, das sich das »Hauptaugenmerk von der Bereitstellung einer Distribution für alte Hardware zu einer funktionalen und dennoch modularen Distribution wandelt, die sich darauf konzentriert, dem Benutzer nicht im Weg zu stehen und sie ihren Computer nutzen zu lassen«. Dazu will Lubuntu moderne, Qt-basierte Technologien und Programme nutzen, um den Anwendern ein funktionales und dennoch modulares Erlebnis zu bieten.