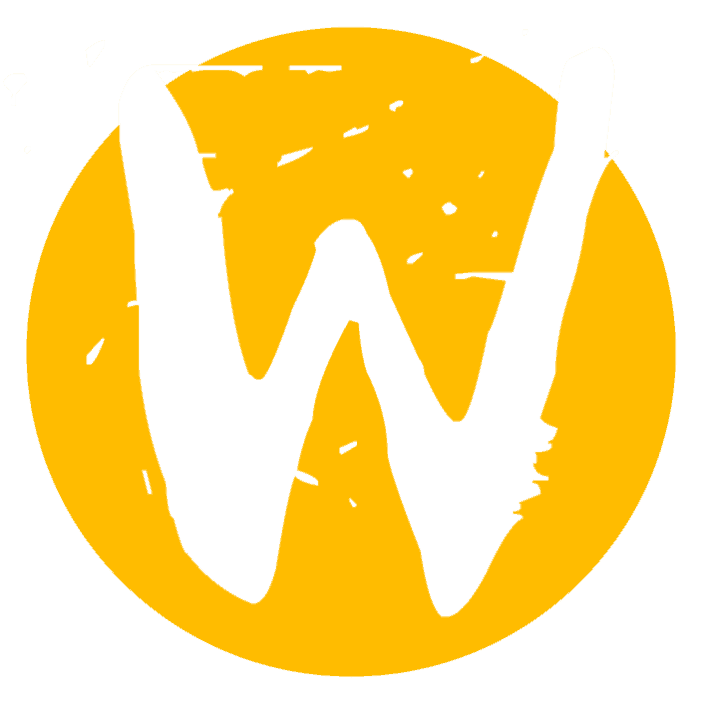Die Veröffentlichung von Debian 10 »Buster« steht in den nächsten Wochen oder Monaten bevor. Als Standard-Desktop kommt wie gehabt GNOME 3 zum Zug. Anders als bei Debian 9 »Stretch« soll dabei Wayland anstatt Xorg als Voreinstellung für das Display-Protokoll dienen.
Red Hat liefert Wayland als Standard aus
Das Wayland-Protokoll wird seit über 10 Jahren entwickelt und schon genauso lange als Ablösung für das überalterte Xorg gehandelt. Aber bisher liefern lediglich Fedora und seit einigen Tagen Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL) Wayland als Standard aus. Bereits im Februar habe ich mich gefragt, wann Wayland generell zum Standard wird.
Ubuntu weiß es noch nicht
Debian entschied sich für das derzeit stabile »Stretch« gegen Wayland als Standard. Canonical stellte mit Ubuntu 17.10 »Artful Aardvark« auf Wayland um, revidierte die Entscheidung jedoch für Ubuntu 18.04 LTS »Bionic Beaver« wieder und kehrte für die langzeitunterstützte Version zu Xorg als Standard zurück. Laut Canonicals Mastermind Mark Shuttleworth soll Ubuntu 20.04 LTS voraussichtlich die erste langzeitunterstützte Version mit Wayland am Steuer sein.
Debian Testing seit 2017
Anwender, die Debian Testing oder Unstable mit Gnome 3 als Desktopumgebung verwenden nutzen bereits seit August 2017 Wayland, sofern sie bei der Installation nicht bewusst Xorg ausgewählt haben. Zu diesen Anwendern zählt auch der Debian-Entwickler Jonathan Dowland, der vor einem Monat auf der Entwicklerliste die Frage stellte, ob Wayland bereit sei, als Standard für Debian 10 zu dienen. In seinem Blog plädiert er nun dafür, Debian 10 mit Xorg als Standard auszuliefern und den Wechsel auf Wayland erst mit dem Nachfolger zu vollziehen.
Kritik an Debians Entscheidung
Dowland wundert sich zunächst, dass es für die Entscheidung zu Wayland nicht die bei Debian übliche ausdauernde Diskussion gab, wie es etwa bei der Entscheidung für Systemd der Fall war. Als Argumente für eine Rückkehr zu Xorg dienen ihm zwei Fehler im ansonsten für ihn zufriedenstellenden Testablauf sowie die Befürchtung, Debian verliere zum jetzigen Zeitpunkt mit Wayland etwas von seiner Vielseitigkeit.
Verlust der Vielseitigkeit befürchtet
Ein Merkmal von Debian sei, dass man den GNOME-Desktop mit Anwendungen aus allen möglichen Ecken des Linux-Ökosystems paaren und so einen angepassten Workflow etablieren könne, Dowlands Befürchtung geht dahin, dass mit Wayland etwas davon verloren gehen wird. In dem Zusammenhang kritisiert er auch das automatische Entfernen von Paketen, die mit Wayland nicht kompatibel sind, wie im Fall des grafischen Paketmanagers Synaptic geschehen. Grund war in dem Fall, dass Synaptic generell als Root läuft, was den Prinzipien von Wayland zuwiderläuft
Zu viele Fehler in Wayland!?
Die Fehler, die Dowland anführt, sind keineswegs esoterisch und können im Alltag jederzeit auftreten. So stirbt etwa der gesamte Desktop samt Session-Manager, wenn die Root-Partition vollläuft. Das lässt sich auch nicht mit Werkzeugen wie systemctl beheben. Es passiert zwar auch unter Xorg, aber die Session bleibt dort laut Dowland zumindest erhalten.
Der zweite Fehler, den Dowland erwähnt tritt beim Drag&Drop von Firefox in den Dateimanager Nautilus auf. Danach werden laut Bugreport alle laufenden X-Applikationen daran gehindert, auf Maus- oder Tastatureingaben zu reagieren. Firefox lässt sich dann nicht mehr normal beenden und muss abgeschossen werden. Obwohl beide Bugreports bereits vom 26. April stammen, gibt es bisher keinerlei Reaktion darauf.
Die Diskussion auf der Mailingliste geht derweil weiter. Die Frage von Dowland, welche Kriterien das GNOME-Team zur Entscheidung für Wayland als Standard genutzt hat, bleibt bisher unbeantwortet.
Den Durchschnittsanwender im Auge behalten
Wer Debian kennt, wird sich vermutlich wundern, dass eine noch relativ unerprobte Technologie, die noch nicht fehlerfrei läuft, von der konservativen und auf absolute Stabilität ausgelegten Distribution relativ früh aufgegriffen wird. Dem durchschnittlichen Anwender ist es egal, was im Hintergrund läuft, solange alles funktioniert. Dieser Anwender wird sich bei der Installation deshalb meist nicht bewusst sein, dass Xorg als erprobte Alternative vielleicht die bessere Wahl ist.
Wayland oder Xorg?
Wenn Red Hat seinen Unternehmenskunden GNOME mit Wayland ausliefert, ist das nicht ein Beweis, dass Wayland bereit für den Mainstream ist? Sollte Debian bei Wayland als Standard bleiben und sich damit wie bei der Entscheidung für Systemd als zukunftsorientierte Distribution verhalten oder lieber Xorg den Vorzug geben, während Wayland die Alternative bleibt?